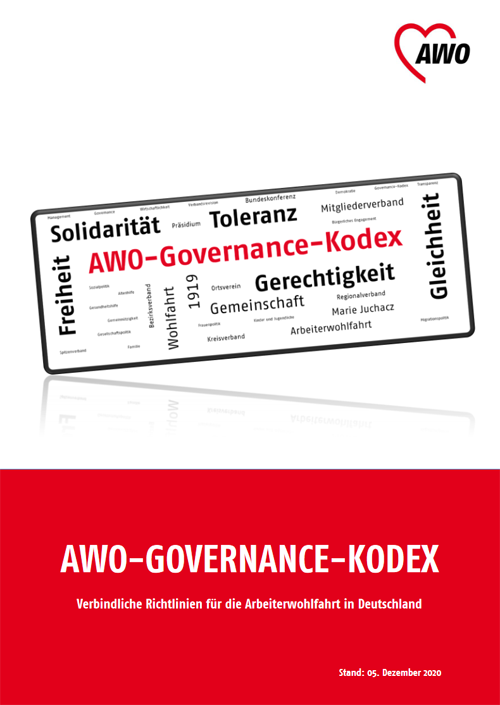AWO-Governance-Kodex 2.0
Verbindliche Richtlinien der AWO in Deutschland für eine verantwortungsvolle Verbands- und Unternehmensführung und -kontrolle
Beschlossen durch den Bundesausschuss am 25.11.2017 in Berlin
Geändert durch den Bundesausschuss am 05.12.2020 in Berlin
Die AWO ist ein zukunftsorientierter Mitgliederverband. Ihre Werte Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit sind Grundlage ihres Handelns in der veränderten Welt des 21. Jahrhunderts. Diese Werte sind im Grundsatzprogramm der AWO festgelegt und für alle verbindlich, die in der AWO Verantwortung tragen.
Die Werte der AWO sind auch Grundlage ihres unternehmerischen Handelns. Unbeschadet der Gesamtverantwortung des AWO-Mitgliederverbandes für die verbandlichen und unternehmerischen Aufgaben haben die sozialen Betriebe der AWO auch eine Eigenverantwortung für die Sicherung der verbandlichen Werteorientierung. Die Werte der AWO sind Orientierung und Leitbild für ihre Führungs- und Leitungskräfte sowie ihre Mitarbeiter*innen.
Entscheidungen über Organisationsstrukturen und Unternehmensformen müssen unter Wahrung der ideellen Aufgaben und der Werte des AWO-Mitgliederverbandes wie der Gleichstellung aller Geschlechter sowie auf der Grundlage unternehmerischer Ziele getroffen werden.
Weitere Downloads rund um den AWO-Governance-Kodex finden Sie hier: https://awo.org/awo-governance-kodex-20